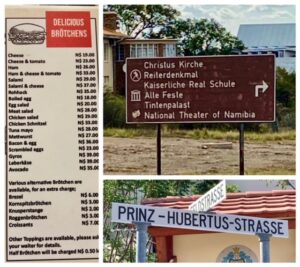Eine ganz genaue Vorstellung von Namibia hatten wir nicht, bevor wir das Land bereisten. Und schon gar kein konkretes Bild vor Augen. Das geht wohl den meisten so. Dabei findet sich in Namibia eines der weltweit am häufigsten photographierten Naturwunder. Sucht man ein spektakuläres Wüstenbild, stößt man fast immer auf die Dünen von Sossusvlei. Das absolute Sinnbild für die Schönheit der Wüste.
Nicht nur die schönsten, auch die höchsten Dünen der Welt sollen es sein, die in diesem Teil des Namib-Naukluft-Nationalparks liegen. Um sie voll und ganz genießen zu können, campen wir am Eingang des Parks. Aber wir verzichten darauf, uns morgens um 7 in die Karawane der Photographen einzureihen, die den Sonnenaufgang auf einer der Dünen erhaschen wollen. Eigentlich sei es um die Zeit gar nicht möglich, ein Bild ohne Menschen, ohne Fußspuren im Sand, ohne springende Instagramer zu machen, sagte uns unser Campingplatzwirt vom Tag zuvor und das kommt uns doch ganz entgegen. Wir sind jetzt wirklich keine Langschläfer, aber morgens brauchen wir erst mal einen sehr gemütlichen Kaffee. Und während wir den schlürfen, starten um uns rum die Autos, um pünktlich zur Öffnung des Parks um 6 Uhr in selbigen zu eilen und es möglichst zum Sonnenaufgang bis zur Düne 45 zu schaffen. Bestimmt kommen sie mit spektakulären Bildern zurück, eine Seite der Düne bereits von der Sonne bestrahlt, eine noch im Schatten liegend. Und klar sind wir etwas neidisch, dass uns dieser Anblick entgeht, aber lieber in der Mittagshitze und dann nur wir und die Düne.
Vom Eingang des Parks führt eine tatsächlich fast bis zum Ende asphaltierte Straße durch die Mondlandschaft, aus der die Dünen in der Ferne herauswachsen. Und diese Weite der Landschaft haben wir tatsächlich ganz allein für uns. Dafür kommen wir aber auch in den Genuss der vollen und schattenlosen Mittagshitze. Aber egal. Die Wüste bezaubert auch so, die Spuren der morgens auf den Dünen herumspringenden Massen sind bereits verweht und so können wir uns der ganzen unberührten Pracht hingeben. Das pralle Orange der gigantischen Dünen vor tiefblauem Himmel, die flirrende Hitze über dem heißen Sand – Wahnsinn. Ich versuche, eine der Dünen zu besteigen, breche es aber schnell ab – jeder Schritt durch den perfekt geformten Sand kommt mir wie eine brutale Zerstörung vor. Wunderbare Motive gibt es auch vom Boden aus.
Ganz am Ende der geteerten Straße, etwa 65 Kilometer vom Eingang entfernt, beginnt die Sandpiste zur größten Düne im Sossusvlei. Ab hier geht es nur noch mit Allradantrieb weiter. Wir steigen am Parkplatz aus und schauen uns das Sandmeer an, durch das man fahren soll. Eigentlich gibt es ein Shuttle, aber weil wir so spät dran sind, hat das bereits Feierabend. Wir entscheiden uns ganz schnell dagegen, den Versuch mit unserem Small car zu wagen. Niemand ist mehr hier, der uns aus dem Sand ziehen könnte. Also starten wir zu Fuß. Ein riesiger Sandkasten. Eine Düne nach der anderen. Und bis zur allergrößten wären es vier Kilometer hin und zurück durch den Sand und die Hitze. Wir gucken uns an – tut es nicht auch die zweitgrößte Düne? Aber klar doch! Also drehen wir um und laufen zurück zum Parkplatz, ganz allein mit dem vielen Sand, ein paar schläfrigen Oryxen und kleinen Wüstenbewohnern, die um die Zeit wohl nicht mehr mit Besuch gerechnet haben.
Wir machen uns auf den Rückweg zum Campingplatz. Und sind so froh, die Wunder dieser Wüste ganz für uns allein gehabt zu haben. Auch wenn wir nicht die größte Düne besteigen konnten und auch wenn das Licht nicht immer optimal war. Aber ist nicht das, was Wüste ausmacht, ihre majestätische Einsamkeit?