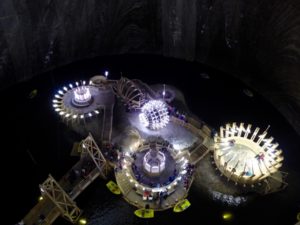Nicht mehr unterwegs sein zu können, ist ein Zustand, an den ich mich wohl oder übel langsam gewöhnen muss. Reisen hat mich immer fasziniert und ich denke, das wird auch immer so sein. Deswegen hilft es doch sehr, die Kraft nicht ständig im buddhistischen Hier und Jetzt zu suchen, sondern auch mal künftige Reisen zu planen oder in die Reisevergangenheit abzutauchen. Gestern war so ein Abend, ich wollte den Computer ein bisschen aufräumen und blieb bei den Photos hängen. Gleich mehrere Stunden. Ging ja auch gut, denn es war der Abend vor dem Feiertag. Es waren sehr schöne Bilder dabei, von Indien, Israel und Indonesien, aber just am Vorabend des Tages der Deutschen Einheit faszinierten mich die Bilder meiner Expeditionen nach Ostdeutschland am meisten.
In den letzten Tagen haben wir viel diskutiert, über die Ursachen und Folgen des Ergebnisses der Bundestagswahlen. Für viele schien es sehr einfach: der Osten ist schuld. Und ganz besonders Sachsen. Höhnisch scheinen viele auf die demokratieunfähigen Hinterwäldler im Osten zu blicken, erst bauen wir denen die Autobahnen und dann das. Aber dann denke ich an den Wahlabend zurück, an die Karte der Bundesländer, in denen die AfD einen überdurchschnittlich hohen Wähleranteil hatte. Und neben den neuen Bundesländern waren auch Bayern und Baden-Württemberg dunkel eingefärbt. In Pforzheim und Heilbronn hat die AfD über 16 % erreicht. In Baden-Württemberg mit seiner boomenden Wirtschaft.
Die neuen Bundesländer waren viele Jahre für mich ein absolut unbekanntes Terrain, exotischer als vieles andere. Ich bin ein typisches Kind des Kalten Krieges, mit der Mauer aufgewachsen, wir hatten Verwandte „drüben“ und deren Not war für meinen konservativen Vater immer der wohltuende Beweis dafür, wie gut der Westen und wie schlecht der Osten war. Wochen vor Weihnachten trug ich die Zonenpakete zur Post, bestückt mit Kaffee, Eierlikör und Feinstrumpfhosen. Am Weihnachtstag musste man früh aufstehen, um das Telefonat nach Plauen anzumelden und es kam dann meistens, wenn die Vorbescherungshektik am größten war. Nie hätte ich gedacht, dass es irgendwann mal anders werden würde mit diesen zwei Deutschlands. Magdeburg, Haldensleben oder Kleinpörthen, die Orte der Kindheit meiner Mutter, schienen unerreichbar wie auf einem fernen Planeten, denn wegen der Flucht meiner Großeltern Anfang der 50er Jahre durften wir alle nicht in die DDR reisen.
Als ich 1989 in Göttingen studierte, überschlugen sich die Ereignisse. Es war ein Samstag und ich hatte ein Wochenendseminar, das früh anfing. Als ich nachmittags auf die am morgen noch leere Straße kam, parkten überall Trabis. Unter jeden Scheibenwischer hatte jemand eine Rose oder eine Tafel Schokolade geklemmt. Als wir nach dem Seminar ein Bier trinken gingen, saß am Nachbartisch eine Familie aus dem Osten, der Mann hatte sich aus Pappe einen Button gebastelt, auf dem „Neues Forum“ stand. Wir blickten sie an wie Außerirdische. Weihnachten 1989 wurde dann die Grenze auch für uns geöffnet. Mein Vater und ich hatten mit meiner Großmutter in Ratzeburg gefeiert, am späteren Abend machten wir uns auf, wir wollten einfach mal rüber. Ratzeburg war immer Zonenrandgebiet gewesen, die Welt hatte immer dicht hinter der Stadt aufgehört, und plötzlich konnten wir die Straße weiter fahren. An den Bäumen hingen Plakate „Willkommen Bundis“ und im ersten Ort im Osten winkten uns am Feuerwehrhaus Leute raus, drückten uns ein Bier und eine Bratwurst in die Hand, aber bei den wortkargen Mecklenburgern kam dann doch wenig Stimmung auf.
In den nächsten Jahren gab’s ein paar kurze Trips in den Osten, ein Vorstellungsgespräch in Cottbus, ein Ausflug nach Eisenach und Weimar, das war’s eigentlich schon. Erst die Ahnenforschung führte mich so richtig in die neuen Bundesländer. Die Familie meines Vaters kommt geschlossen aus Pommern, zehn Kilometer rund um Schivelbein, dem heutigen Swidwin. Was ich nie gedacht hätte: auch mütterlicherseits bin ich eine pure Ostpflanze. Mein Opa wuchs im Drei-Länder-Eck Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen auf, seine Vorfahren kommen aus Sachsen und Brandenburg, wahrscheinlich waren einige Sorben unter ihnen. Die Wurzeln meiner Oma liegen in Sachsen-Anhalt und Thüringen. Erstaunt stellte ich fest, dass ich der ersten Generation angehöre, die im Westen geboren wurde.
 Und dann bin ich hingefahren. Zuerst nach Kleinpörthen, wo ich das Grab meines Ururgroßvaters fand, ein winziges Dorf in einer hoffnungslosen Gegend. Ich blieb ein paar Tage in der Kreisstadt Zeitz, ein typisches Oststädtchen, viele historische Gebäude sehr schön renoviert, vieles aber auch noch verfallen, in der Fußgängerzone halten sich maximal zwei Discounter und über dem ganzen Ort liegt eine merkwürdige Mischung aus Nostalgie und Resignation. Geburtsurkunde um -urkunde führt
Und dann bin ich hingefahren. Zuerst nach Kleinpörthen, wo ich das Grab meines Ururgroßvaters fand, ein winziges Dorf in einer hoffnungslosen Gegend. Ich blieb ein paar Tage in der Kreisstadt Zeitz, ein typisches Oststädtchen, viele historische Gebäude sehr schön renoviert, vieles aber auch noch verfallen, in der Fußgängerzone halten sich maximal zwei Discounter und über dem ganzen Ort liegt eine merkwürdige Mischung aus Nostalgie und Resignation. Geburtsurkunde um -urkunde führt  mich weiter an Orte, die ich sonst nie im Leben besucht hätte: das untergegangene Wuitz, ein Opfer des Tagebaus und Geburtsort meines Opas, das schöne Altenburg und die pittoresken sächsischen Städtchen, in denen meine Vorfahren dem Bierbrauen frönten. In Hohenstein-Ernstthal lebten sowohl Karl May als auch meine Urururgroßmutter, sie wurde in der Kirche getauft, in der er geheiratet hat. Die
mich weiter an Orte, die ich sonst nie im Leben besucht hätte: das untergegangene Wuitz, ein Opfer des Tagebaus und Geburtsort meines Opas, das schöne Altenburg und die pittoresken sächsischen Städtchen, in denen meine Vorfahren dem Bierbrauen frönten. In Hohenstein-Ernstthal lebten sowohl Karl May als auch meine Urururgroßmutter, sie wurde in der Kirche getauft, in der er geheiratet hat. Die

Landschaft ist toll, das Essen lecker. Ich machte einen kurzen Abstecher nach Leipzig und hier wehte ein anderer Wind. Der Geist des Widerstands scheint hier immer noch lebendig, ganz besonders in der Nikolaikirche. Über das schöne Torgau gelangte ich nach Brandenburg. In Tröbitz lebten meine Vorfahren über einige Generationen hinweg, der pittoreske alte Ortskern steht noch, die Plattenbauten am Rande des Ortes sind furchtbar. Hier über Land zu fahren bedeutet eine Reise durch Geisterstädte. Die Dörfer sind wie ausgestorben, fast jeder Laden ist geschlossen und zu verpachten, wer hier ausharrt, muss entweder besonders heimatverbunden oder chancenlos sein. In jedem der kleinen Orte, die ich aus alten Geburts- oder Sterbeurkunden meiner Ahnen kenne, schloss ich kurz die Augen und stellte mir vor, wie ihr Leben wohl gewesen sein mag, im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Arm waren sie alle, die meisten kleine Bauern, ein paar Lehrer, so wie mein Ururgroßvater Moritz Noack, der seine Heimat Tröbitz gen Kleinpörthen verließ und dort über 40 Jahre lang ein geachteter, aber auch gefürchteter Dorfschullehrer war. Die Chronistin von Kleinpörthen, die mich auf dem Friedhof ansprach – „Wir haben hier nicht so viele Autos aus dem Westen“ – hat es mir erzählt.
Der Tag der deutschen Einheit, das ist ja eigentlich mein Aufhänger. Ich bin froh, dass es diese Einheit gibt, Ich finde es nach wie vor unfassbar, hinter Hof oder Gudow oder Helmstedt einfach über die ehemalige Grenze fahren zu können. Im Einheitsprozess sind Fehler gemacht worden, ganz schwerwiegende Fehler. Die Dollarzeichen hatten alle in den Augen, in West wie Ost, und darüber hat man die Menschen vergessen. Wer über den Osten schimpft, sollte ihn sich erst mal anschauen. Mal ganz kurz die Hoffnungslosigkeit erahnen. Und überlegen, wie wir das jetzt nachholen können, was damals versäumt wurde. Nicht als Besserwessi, der dem Osten mal erzählen muss, wie das eigentlich funktioniert mit der Moral. Denn warum sollen 25 % in Sachsen so exorbitant anders sein als 16% in Heilbronn? Fehlgeleitete Menschen gibt es überall, das ist kein spezifisches West- oder Ostproblem. Als Globonautin und Mensch mit Wurzeln im Osten kann ich nur sagen: ich bin froh und sehr dankbar, dass es diese Grenze nicht mehr gibt.




























































 beschließe ich jedenfalls, ein paar Tage stationär zu bleiben. In Hermannstadt trenne ich mich von dem braven Polo und setze mich in die Bahn Richtung Brasov, zu deutsch Kronstadt. Die Fahrt ist gemächlich, dreieinhalb Stunden für 160 Kilometer und dann stehe ich am Bahnhof von Brasov. Der Bus in die Stadt ist schon da, ich springe hinein und frage den Fahrer nach einem Ticket. Er deutet in Richtung eines Automaten und ich versuche ihm klar zu machen, er möge doch bitte
beschließe ich jedenfalls, ein paar Tage stationär zu bleiben. In Hermannstadt trenne ich mich von dem braven Polo und setze mich in die Bahn Richtung Brasov, zu deutsch Kronstadt. Die Fahrt ist gemächlich, dreieinhalb Stunden für 160 Kilometer und dann stehe ich am Bahnhof von Brasov. Der Bus in die Stadt ist schon da, ich springe hinein und frage den Fahrer nach einem Ticket. Er deutet in Richtung eines Automaten und ich versuche ihm klar zu machen, er möge doch bitte